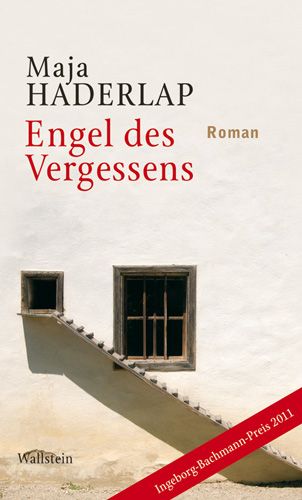Engel des Vergessens
Autor: Maja Haderlap
Verlag: wallstein
Umfang: 288 Seiten
Kurzinformation zum Buch
Ein großes Romandebüt, das von einem Leben in der Mitte Europas erzählt; mit kraftvoller Poesie; Geschichten, die uns im Innersten betreffen.
Maja Haderlap gelingt etwas, das man gemeinhin heutzutage für gar nicht mehr möglich hält: Sie erzählt die Geschichte eines Mädchens, einer Familie und zugleich die Geschichte eines Volkes. Erinnert wird eine Kindheit in den Kärntner Bergen. Überaus sinnlich beschwört die Autorin die Gerüche des Sommers herauf, die Kochkünste der Großmutter, die Streitigkeiten der Eltern und die Eigenarten der Nachbarn. Erzählt wird von dem täglichen Versuch eines heranwachsenden Mädchens, ihre Familie und die Menschen in ihrer Umgebung zu verstehen. Zwar ist der Krieg vorbei, aber in den Köpfen der slowenischen Minderheit, zu der die Familie gehört, ist er noch allgegenwärtig. In den Wald zu gehen hieß eben »nicht nur Bäume zu fällen, zu jagen oder Pilze zu sammeln«. Es hieß, sich zu verstecken, zu flüchten, sich den Partisanen anzuschließen und Widerstand zu leisten. Wem die Flucht nicht gelang, dem drohten Verhaftung, Tod, Konzentrationslager. Die Erinnerungen daran gehören für die Menschen so selbstverständlich zum Leben wie Gott. Erst nach und nach lernt das Mädchen, die Bruchstücke und Überreste der Vergangenheit in einen Zusammenhang zu bringen und aus der Selbstverständlichkeit zu reißen - und schließlich als (kritische) junge Frau eine Sprache dafür zu finden. Eindringlich, poetisch, mit einer bezaubernden Unmittelbarkeit.
Leseprobe aus »Engel des Vergessens«
Großmutter gibt mir ein Zeichen mit der Hand, ich solle ihr folgen.
Wir gehen durch die schwarze Küche in die Speisekammer. Am Gewölbe klebt alter Rauch wie dunkles, speckiges Harz. Es riecht nach Geselchtem und frischgebackenem Brot. Ein saurer Dunst hängt über den Futterkübeln, in denen Essensabfälle für die Schweine gesammelt werden. Der Boden ist lehmig und an den häufig begangenen Stellen glänzend wie poliert. In der Speisekammer schöpft Großmutter gehärtetes Schweineschmalz aus einem Topf und streicht es in den Bräter, dann fährt sie mit einem Löffel in die Apfelmarmelade und nimmt eine weißgraue Schimmelschicht ab, die sie zu den Abfällen wirft. Malada steht auf den Etiketten, die sie mit einem Brei aus Mehl, Milch und Speichel auf die Gläser geklebt hat. Ihre Malada ist dunkelbraun und schmeckt bittersüß. Sie legt mir eine handvoll Eier in den Rock, den ich hochhalte. Im Durchzug lösen sich Rußflocken von den Wänden in der schwarzen Küche und legen sich auf die Brotlaibe, die hochgestellt auf einem Holzregal lagern. Unter dem Ofenloch, neben der Eingangstür, liegt zusammengekehrt ein Häuflein Asche.
Großmutter arbeitet in der Küche. Die Speisen, die sie zubereitet, schmecken nach schwarzer Küche, nach der dunklen, schlecht beleuchteten Grotte, die wir täglich ein paar Mal durchqueren. Alles Essbare, scheint mir, nimmt den Geruch und die Farbe der Rauchküche an. Der Speck und das Heidenmehl, das Schmalz und die Marmelade, sogar die Eier riechen nach Erde, Rauch und gesäuerter Luft. Während des Kochens teilt Großmutter den Speisen Eignungen zu. Ihre Gerichte haben eine verborgene Kraft, sie können das Diesseits mit dem Jenseits verbinden, sichtbare und unsichtbare Wunden heilen, sie können krank machen.
Ich trinke den Malzkaffee aus der Flasche, die sie für mich in der untersten Lade der Küchenkredenz versteckt hält. Du bist zu groß für die Flasche, sagt sie, aber solange du willst, werde ich sie dir bereiten. Ich lege mich auf die Küchenbank, um mich aus dem Blickfeld zu nehmen und sauge den frisch zubereiteten Kaffee. Viel zu groß, wiederholt Großmutter. Wenn jemand kommt, stellst du die Flasche sofort auf den Boden.
Großmutter meint, dass meine Mutter zu unerfahren sei für die Küche. Sie habe keine Ahnung, wie man koche, und was ihr die Nonnen in der Schule beigebracht haben, passe nicht in unser Haus. Sie wisse auch nicht, dass es Speisen für Lebende und für Tote gibt, dass man Menschen mit eigens zubereiteten Gerichten heilen oder verderben kann, das wolle sie ihr tatsächlich nicht glauben. Ich hingegen glaube Großmutter aufs Wort, und drehe begeistert die Kurbel, wenn sie den Hafer röstet für den Kaffee. Ich höre ihr zu, wenn sie erzählt, für wie viele Menschen sie schon gekocht hat, damals zu Hause, als es noch Knechte und Mägde gab und sehr viele Kinder. Sie sagt, sie habe auch Essen gestohlen für sich und die anderen, sie habe nach jeder Kartoffelschale gesucht, nach allem, was essbar schien, damals, als sie die Kessel gewaschen hat, das war noch ein Glück, sagt sie, dass sie dahin gekommen sei, in die Küche, im Lager, ich weiß.
Nach dem Abwasch legt sie die emaillierten Schälchen und Töpfe zum Abtropfen auf das Fensterbrett. Das Abwaschwasser aus der Blechschüssel schüttet sie ins Freie. Ihre langen geröteten Finger sind nach dem Spülen violett. Sie sehen aus wie Krallen eines Greifvogels. Ab und zu pocht sie mit ihnen auf meinen Kopf. Mit einem Schürhaken hebt sie ein tellergroßes Gusseisenteil aus der Herdplatte des Sparherds und zerteilt die Glut, damit sie rascher auskühlt.
Kaum setzt sie sich in Bewegung, folge ich ihr. Sie ist meine Bienenkönigin und ich bin ihre Drohne. Ich habe den Duft ihrer Kleidung in der Nase, den Geruch nach Milch und Rauch, einen Hauch von bitteren Kräutern, der an ihrer Schürze haftet. Sie gibt mir den Rundtanz vor und ich tänzle ihr nach. Ich passe meine kleinen Schritte ihren schleppenden an, ich summe eine zarte Melodie aus Fragen und sie spielt den Bass.
Wir gehen in die Stube und sehen nach der Milchzentrifuge hinter der Tür, die wir ein paar Mal in der Woche drehen, um den Rahm von der Milch zu trennen. In der Kammer dahinter werden die Fenster geöffnet, die Betten, in denen wir schlafen, gelüftet, die Strohsäcke, die gefüllt sind mit getrockneten Maisblättern, aufgelockert, die Kräuter, die auf dem Fensterbrett liegen oder an Vorrichtungen aufgehängt sind, gewendet und kontrolliert, wird die Treppe hinauf auf den Dachboden gestiegen, der unheimlich wirkt, in die Dachkammer geschaut, in die sich vor Jahren Gespenster geflüchtet haben zu den Schlafenden und sie aus dem Zimmer gejagt haben, wie Großmutter erzählt.
Großmutter tänzelt ins Freie und bindet den gelben Ranunkelstrauch vor der Scheune an den Zwetschkenbaum. Sie spricht den Holunderbusch neben dem Misthaufen an, damit er rascher erblühe. Dann kommt sie zurück, um mich zu holen. Wir gehen über den Hof zu den Futterquellen im unteren Keller und im Speicher. Sie öffnet Mehlsäcke, Truhen und Holzkübel, sie füllt ihre Schürzentaschen mit frischem oder gedörrtem Obst, sie streut Weizen und Maiskörner für die Hühner aus. Ihre Stirn ist gerunzelt wie die Schindelbretter des Daches über dem Getreidespeicher. Sie eilt mir voraus, will zur Dörre am Bach und nach den Lattenrosten sehen, auf denen im Herbst die Zwetschken und Birnen getrocknet werden. Zweimal in der Woche überprüft sie mit mir die Legeplätze der Hennen in den Geräteschuppen und auf der Tenne. Liegen bis Ende der Woche in einem Nest keine Eier, sucht sie das Tier, das sie im Verdacht hat, mit dem Legen zu trödeln. Kommt es in ihre Nähe, greift sie überfallsartig nach dem kreischenden Federvieh und fährt ihm mit dem Zeige- und Mittelfinger in den After. Blitzt unter ihren Fingern etwas Weißes hervor, sagt sie, das Ei komme morgen oder übermorgen, es habe noch eine weiche Schale.
Einmal holt sie zu meinem Vergnügen ein Ei aus der Henne, das in ihren Händen zerfließt. Ich muss lachen. Eiermädchen, nennt mich Großmutter. Den Namen habe mir Großvater gegeben, erzählt sie, als er krank auf der Ofenbank lag und auf mich Acht geben musste. Ich sei ein Schoßkind gewesen, kaum mehr als ein Jahr alt und habe die Eier in der untersten Lade der Stubenkredenz entdeckt, sie einzeln über den Holzboden rollen lassen und sobald das Eigelb aus der Schale getreten war, sonãi gre, gerufen, das Sonnchen geht auf! Großvater habe mich beobachtet und sei so begeistert gewesen, dass er mich die Schüssel ausräumen ließ und ihr verboten habe, mit mir zu schimpfen. Er habe gemeint, während sie die Eierspeise vom Boden aufwischte, dass man mit mir und mit ihm Mitleid haben müsse. Bald danach sei er gestorben, obwohl ich ihn unterhalten hätte.
Nur beim Teigkneten schätzt Großmutter die Hilfe von Mutter. Dann schaut sie ihr zu, wie sie das Mehl rührt. Im Teigtrog schmatzt es und patzt es. Schweißtropfen bilden sich auf Mutters Stirn und fallen ins werdende Brot. Sie richtet sich auf und wischt mit dem Oberarm den Schweiß aus dem Gesicht. Ihre Wangen sind rot, die Ärmel der Bluse hochgekrempelt, im Halsausschnitt kann ich ihr Unterhemd sehen. Sie fragt, wie das Verhältnis von Roggen und Weizenmehl sei und das von Sauerteig und Wasser, sie würde gern wissen, wie viele Kilo Mehl. Großmutter sagt, wenn das Mehl diese Rille der Trogwand bedeckt, ist es gut. Dann beugt sich Mutter wieder über den Teig. Wenn er sich von ihren Fingern zu lösen beginnt und der Trog nicht mehr knarrt, hat sie die Arbeit geschafft. Großmutter schneidet ein Kreuz in den Teig und bedeckt ihn zum Gehen. Zwei Stunden nachdem Großmutter den Ofenrachen mit den grauweißen Mehlbäuchen gefüttert hat, gibt der Ofen die Brotlaibe wieder her. Das heiße gebackene Brot wird aus dem Ofenmaul gezogen, mit einem Tuch abgewischt, bekreuzigt und in meine Schürze gelegt. Ich trage das Brot in die Stube zum Kühlen und schiebe es auf den Tisch oder auf die geräumige Ofenbank. Der Duft nach frischem Brot durchweht das Haus. Großmutter schreitet die Räume ab, als ob sie sich vergewissern wollte, ob die Sauerteigschwaden wohl jede Ecke des Hauses erreicht haben.
So wenig Brot gab es zu essen im Lager, so wenig, deutet sie mit dem Daumen und dem Zeigefinger die Größe der Brotstücke an, die den Häftlingen zugeteilt wurden. Es musste reichen für einen Tag, manchmal für zwei. Später bekamen wir nicht einmal das, sagt sie, und haben das Brot phantasiert. Ich blicke sie an. Sie sagt, wie sie immer sagen wird, je bilo ãudno, es war befremdend, sagt sie und meint, es war schrecklich, aber grozno fällt ihr nicht ein.